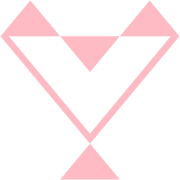Zuhause

Wir wissen
– so viel ist klar. Sicherlich kann man alles bezweifeln, z.B. dass es überhaupt ein Anderes gibt, mit dem zusammen ein Wir gebildet werden kann. Oder dass irgendetwas wirklich Wissen ist, nicht nur Vermutung oder gar Illusion. Aber letztlich ist jeder Zweifel nur die Kehrseite des Wissens. Ohne den Begriff des „Wissens“ und der mehr oder weniger deutlichen Vorstellung davon, was wir damit meinen, wenn wir behaupten, etwas zu wissen, könnten wir uns kein Bild von Illusion, Irrtum oder Lüge machen. Und ohne ein Anderes gäbe es auch kein Dieses oder Eigenes, kein Ich, gäbe es überhaupt nichts.
Unterscheidung ist unerlässlich für jede Art von Wissen. Was immer gesagt, beschrieben, gezeichnet oder sonstwie dargestellt wird, was immer verstanden, gehört, gesehen, gefühlt oder sonstwie wahrgenommen wird – es muss irgendwie unterscheidbar sein. Seine Existenz muss sich abheben von dem, was es nicht ist. Ob es eine deutliche Grenze gibt, ein klares Gegenteil, oder nur ein leichtes Verschieben des Akzentes, das steht auf einem anderen Blatt.
Unterschiede können wir nur erleben, wenn wir irgendwie fortschreiten. Wenn wir, in welcher Form auch immer, aktiv sind. Und andererseits könnte nicht von „Aktivität“ gesprochen werden, wenn nichts sich verändern würde.
Wissen ist aktiv: wir wissen.
Auch das Wir ist wichtig, eigentlich unverzichtbar. Zum Wissen gehört eine Gemeinschaft. Wir geben unserem Wissen Ausdruck, tauschen uns aus über unser Wissen. Erst die Form, die wir ihm zum Zwecke der Kommunikation geben, macht es reproduzierbar und auch in Zukunft verfügbar.
Ohnehin kann jedes Einzelne schon als Gemeinschaft angesehen werden, als Zusammenschluss oder Summe verschiedener, nämlich irgendwie unterscheidbarer, Bestandteile. Und das Sein als Einzelnes ist immer auch Teilhabe an einer Gruppe, die aus diesen Einzelnen gebildet wird, aus den einzelnen Exemplaren: das Einzelne ist ein Beispiel oder Vertreter der Gruppe, Art, Spezies.
Die Organisation menschlicher Gesellschaften, wie wir sie kennen, beruht nicht unwesentlich auf Vereinzelung und der Identität des Ichs. Sie ermöglicht so etwas wie Besitz und Verantwortlichkeit gegenüber einer wie auch immer gearteten Obrigkeit. Damit wir in dieser Weise funktionieren und uns selbst und andere als eine bestimmte Person begreifen, müssen wir viel lernen. Dadurch entsteht ein Wissen, das unser ganz persönliches wird – aber trotzdem nur als in einem größeren Kontext eingebettetes möglich ist.
Dieser Kontext, der Hafen, in dem wir uns sicher fühlen, ist nur selten klar definiert. Das Wir verändert sich. Seine jeweilige Form hängt eng mit unserem jeweiligen Wissen zusammen. Und entsprechenden Aktivitäten.
Wir – und die Anderen: etwas Fremdes bleibt immer, wenn auch möglichst weit draußen. Etwas irgendwie Unbekanntes. Dennoch wissen wir einiges darüber. Und oft ist die Fremdheit auch verlockend, will überwunden werden, zum Bekannten werden. Die Erkenntnis, dass da überhaupt noch etwas Anderes ist, ist schon ein Anfang.
Eine Menge Wissen wartet da draußen, soll zu dem unseren werden. Auf dem Weg dorthin aber werden wir selbst zu einem Anderen. Nur so ist Wissen möglich.
Und so ist womöglich das innigste Geheimnis des Wissens die Einsicht in die Quelle allen Seins: in uns.